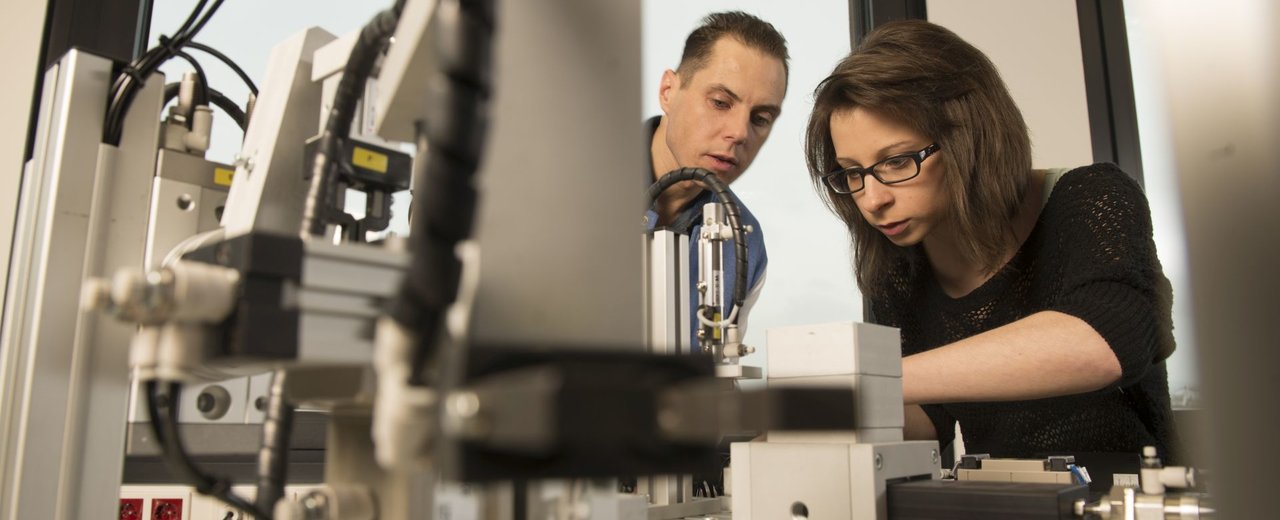Forschung an österreichischen Fachhochschulen hat in den vergangenen Jahren ein zweistelliges Wachstum hingelegt. Die FH Technikum Wien zählt in diesem Bereich zu den Top 5, ist Heimat eines äußerst erfolgreich operierenden Josef Ressel Zentrums und hat mit einigen Forschungsprojekten für Aufsehen gesorgt.
Fehler im System werden oft dann erst bemerkt, wenn nichts mehr funktioniert. Bei Geräten in der Medizin- oder Verkehrstechnik können Fehler durchaus fatale Folgen haben. Seit Oktober 2013 leitet Martin Horauer, Studiengangsleiter Elektronik, das erste Josef Ressel Zentrum an der FH Technikum Wien (FHTW) und forscht an der frühzeitigen Erkennung von Fehlern in Embedded Computing Systems. „Elektronische Steuergeräte sind bereits so sehr in den Alltag integriert, dass sie oft nicht mehr wahrgenommen werden – es sei denn, sie funktionieren nicht“, so Martin Horauer. „Wir testen neue Lösungen, unter anderem die so genannte Runtime-Verifikation: Dabei wird das Testsystem bereits in die Anwendung integriert und beide arbeiten gleichzeitig. Der Vorteil ist: Wird ein Fehler zur Ausführungszeit erkannt, kann die Anwendung entsprechend darauf reagieren.“
Das Josef Ressel Zentrum an der FH Technikum Wien ist ein Paradebeispiel für anwendungsorientierte Forschung in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, wie Fritz Schmöllebeck, Rektor der FH Technikum Wien, den Kern von fachhochschulischer Forschung auf den Punkt bringt. Finanziert wird das Josef Ressel Zentrum vom Wirtschaftsministerium. Einen beträchtlichen Teil der Förderung tragen die Unternehmenspartner Siemens Österreich, Infineon, Kapsch TrafficCom, LOYTEC electronics und Oregano Systems bei. Gemeinsam formulierte das Konsortium Forschungsfragen, die daraus gewonnenen Ergebnisse sollen in neue Produkte oder Verfahren einfließen und einen wirtschaftlichen Nutzen für die Unternehmen darstellen.
"Die Anzahl und Qualität der Veröffentlichungen übertreffen die Erwartungen an ein Zentrum für angewandte Forschung sehr deutlich."
Aus dem Evaluierungsbericht des Zentrums durch die Christian Doppler Gesellschaft
Nun liegt eine erste Evaluierung des Zentrums durch die Christian Doppler Gesellschaft vor: „Die Anzahl und Qualität der Veröffentlichungen übertreffen die Erwartungen an ein Zentrum für angewandte Forschung sehr deutlich“, heißt es dort. Die Kooperation mit den beteiligten Firmen sei hervorragend, die erzielten Ergebnisse hätten großen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der kooperierenden Firmen sowie auch darüber hinaus. „Wir sind stolz, dass wir ein geschätzter Forschungspartner für namhafte Institutionen und Firmen sind“, zieht Michael Würdinger, Geschäftsführer der FH Technikum Wien, Resümee.
Keine Lehre ohne Forschung
„Wir haben einige herausragende Forschungspersönlichkeiten an der FH, die sich durch Neugierde und Freude auszeichnen, etwas Nützliches entwickeln zu wollen“, schätzt sich Schmöllebeck glücklich. „Wir sind kurz davor, das Human Ressources Excellence in Research Gütesiegel der Europäischen Kommission zu bekommen.“
Diese Begeisterung schlägt sich im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens auch in den F&E-Zahlen nieder: Die Zahl der geförderten Projekte sowie Aufträge aus der Wirtschaft haben stark zugenommen. Derzeit arbeiten die Teams an mehr als 60 Projekten mit einem Volumen von 3,5 Mio. Euro. Die FH Technikum Wien zählt damit zu den Top 5 der österreichischen Fachhochschulen.
Forderung nach Basisfinanzierung
Es wäre deutlich mehr möglich, würde den FHs – ähnlich den Universitäten – eine Basisfinanzierung für Forschung zur Verfügung gestellt, fordert Schmöllebeck. „Wir haben ein Rechnungsmodell für unsere FH angestellt: Würde man zehn Prozent der Bundesförderungsmittel für die FH-Lehre als Basisförderung in die Forschung stecken, könnten wir das Forschungsvolumen verdoppeln. Eine enorme Hebelwirkung, für die wir uns mit Nachdruck einsetzen.“ „Für die FH Technikum Wien bedeutet das, sich auf vier Forschungsschwerpunkte zu fokussieren: eHealth, Embedded Systems, Erneuerbare Energie inklusive urbaner Mobilität sowie Tissue Engineering“, so Giuliana Sabbatini, Leiterin der Forschungsorganisation. Gleichzeitig wird bewusst eine gewisse Vielfalt in Nischen zugelassen.
Die Stärke der FH-Forschung ist ihre Nähe zur Wirtschaft. Laut FHK wurden 2013 knapp 1.500 Kooperationen mit Unternehmen abgewickelt, mehr als die Hälfte davon auch mit Kleinund Mittelunternehmen. „Als FH haben wir keine Berührungsängste, ganz im Gegenteil“, so Schmöllebeck. De facto können Unternehmen mit schnelleren, anwendbaren Ergebnissen rechnen.